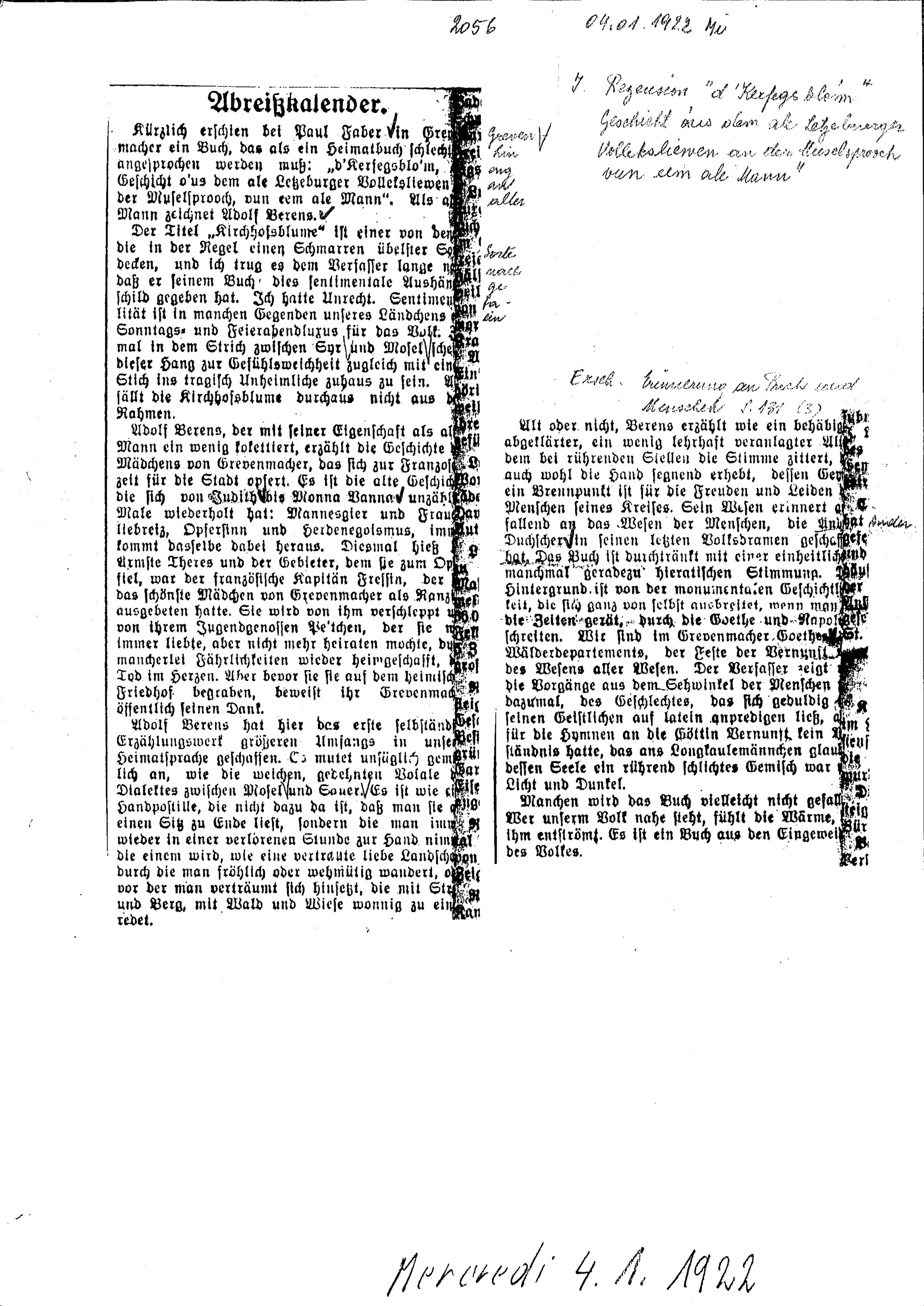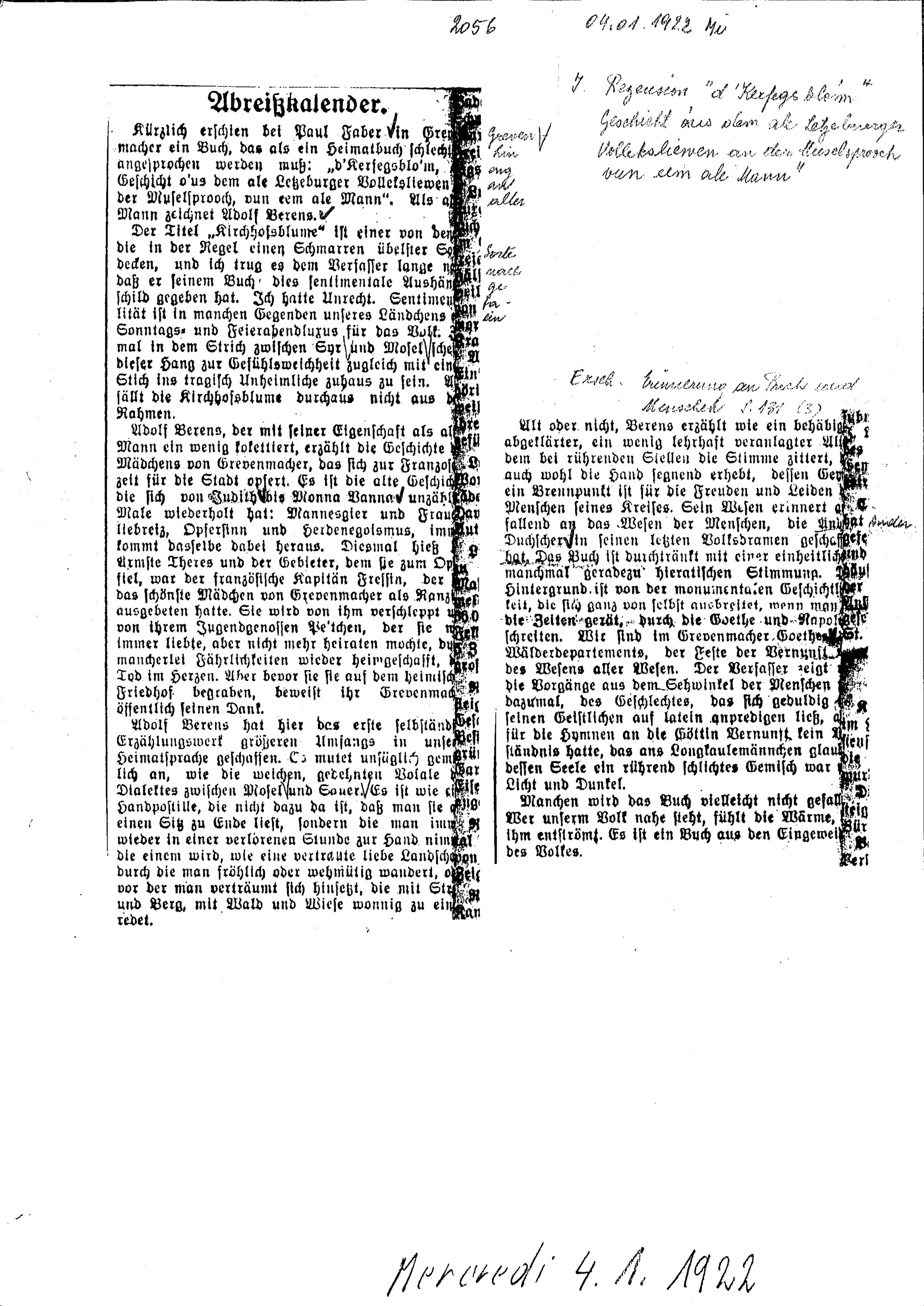
Kürzlich erschien bei Paul Faber in Gre macher ein Buch, das als ein Heimatbuch schlecht hin angesprochen werden muß: „d’Kerfegsblo’m, Geschicht o’us dem ale Letzeburger Volleksliewen all der Muselsprooch, vun eem ale Mann“. Als allen Mann zeichnet Adolf Berens.
Der Titel „Kirchhofsblume“ ist einer von denen, die in der Regel einen Schmarren übelster Sorte decken, und ich trug es dem Verfasser lange nach daß er seinem Buch dies sentimentale Aushängeschild gegeben hat. Ich hatte Unrecht. Sentimentalität ist in manchen Gegenden unseres Ländchens ein Sonntags- und Feierabendluxus für das Volk. Zu mal in dem Strich zwischen Syr und Mosel sche dieser Hang zur Gefühlsweichheit zugleich mit einem Stich ins tragisch Unheimliche zuhaus zu sein. Aber fällt die Kirchhofsblume durchaus nicht aus dem Rahmen.
Adolf Berens, der mit seiner Eigenschaft als alter Mann ein wenig kokettiert, erzählt die Geschichte Mädchens von Grevenmacher, das sich zur Franzosenzeit für die Stadt opfert. Es ist die alte Geschichte, die sich von Judith bis Monna Vanna unzählige Male wiederholt hat: Mannesgier und Frauenliebreiz, Opfersinn und Herdenegoismus, immer kommt dasselbe dabei heraus. Diesmal hieß die ärmste Theres und der Gebieter, dem sie zum Opfer fiel, war der franzöfische Kapitän Fressin, der das das schönste Mädchen von Grevenmacher als Ranz ausgebeten hatte. Sie wird von ihm verschleppt und von ihrem Jugendgenossen Pe’tchen, der sie immer liebte, aber nicht mehr heiraten mochte, durch mancherlei Fährlichkeiten wieder heimgeschafft, der Tod im Herzen. Aber bevor sie sie auf dem heimischen Friedhof begraben, beweist ihr Grevenmacher öffentlich seinen Dank.
Adolf Berens hat hier des erste selbständige Erzählungswerk größeren Umfangs in unserer Heimatsprache geschaffen. Es mutet unsäglich gemählich an, wie die weichen, gedehnten Vokale des Dialektes zwischen Mosel und Sauer. Es ist wie eine Handpostille, die nicht dazu da ist, daß man sie auf einen Sitz zu Ende liest, sondern die man immer wieder in einer verlorenen Stunde zur Hand nimmt die einem wird, wie eine vertraute liebe Landschaft durch die man fröhlich oder wehmütig wandert, oder vor der man verträumt sich hinsetzt, die mit Str und Berg, mit Wald und Wiese wonnig zu einem redet.
Alt oder nicht, Berens erzählt wie ein behäbiger, abgeklärter, ein wenig lehrhaft veranlagter Al dem bei rührenden Stellen die Stimme zittert, auch wohl die Hand segnend erhebt, dessen Ge ein Brennpunkt ist für die Freuden und Leiden des Menschen seines Kreises. Sein Wesen erinnert auffallend an das Wesen der Menschen, die Än Duchscher in seinen letzten Volksdramen geschafft hat. Das Buch ist durchtränkt mit einer einheitlichen manchmal geradezu hieratischen Stimmung. @ Hintergrund ist von der monumentalen Geschichtlichkeit, die sich ganz von selbst ausbreitet, wenn man die Zeiten gerät, durch die Goethe und Napoleon schreiten. Wir sind im Grevenmacher Goethes Wälderdepartements, der Feste der Vernunst des Wesens aller Wesen. Der Verfasser zeigt die Vorgänge aus dem Sehwinkel der Menschen dazumal, des Geschlechtes, das sich geduldig seinen Geistlichen auf latein anpredigen ließ, aber für die Hymnen an die Göttin Vernunft kein Verständnis hatte, das ans Longkaulemännchen glaubt dessen Seele ein rührend schlichtes Gemisch war Licht und Dunkel.
Manchen wird das Buch vielleicht nicht gefallen. Wer unserm Volk nahe steht, fühlt die Wärme, ihm entströmt. Es ist ein Buch aus den Eingeweiden des Volkes.