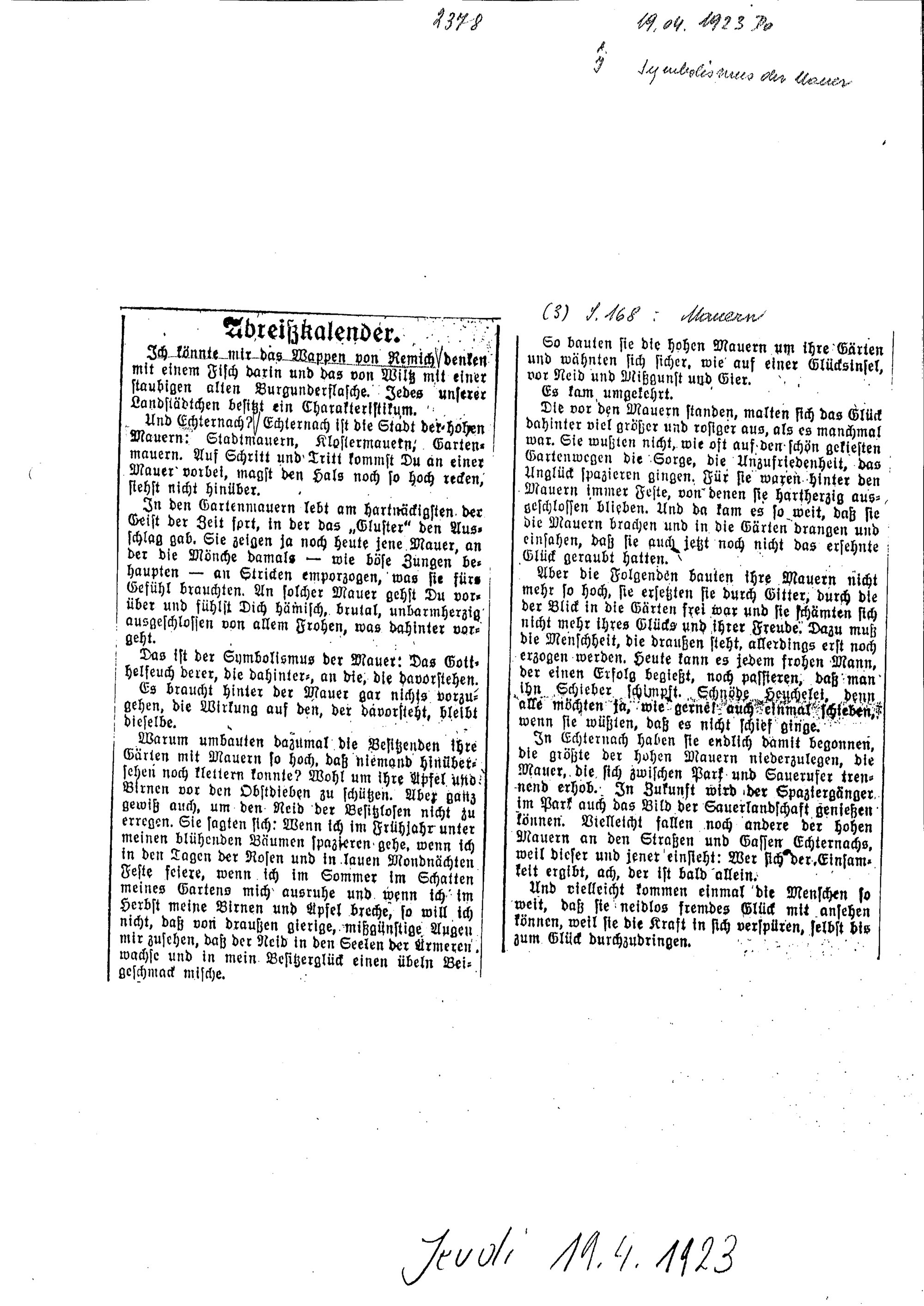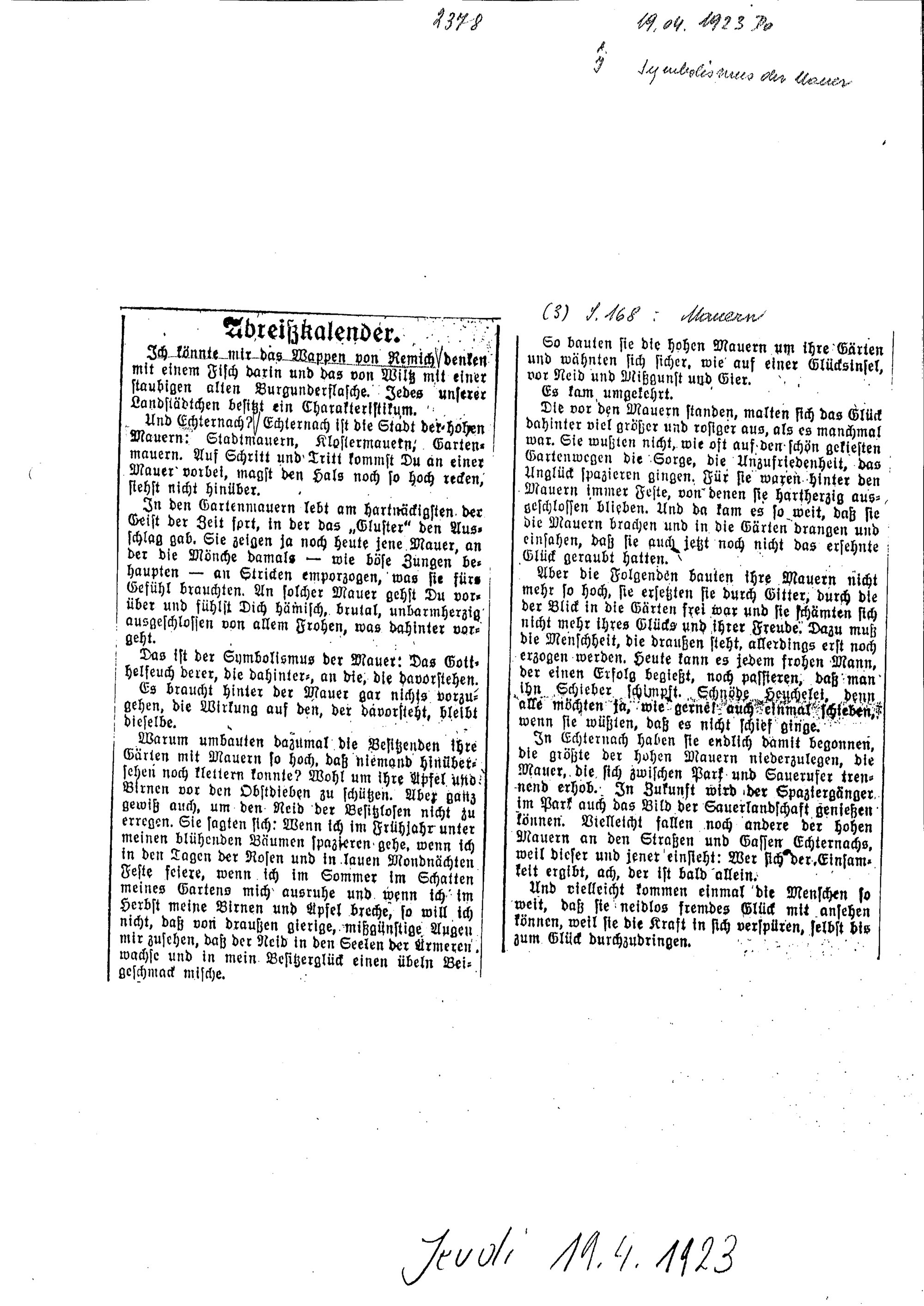
Ich könnte mir das Wappen von Remich denken mit einem Fisch darin und das von Wiltz mit einer staubigen alten Burgunderflasche. Jedes unserer Landstädtchen besitzt ein Charakteristikum.
Und Echternach? Echternach ist die Stadt der hohen Mauern: Stadtmauern, Klostermauern, Gartenmauern. Auf Schritt und Tritt kommst Du an einer Mauer vorbei, magst den Hals noch so hoch recken, siehst nicht hinüber.
In den Gartenmauern lebt am hartnäckigsten der Geist der Zeit fort, in der das „Gluster“ den Ausschlag gab. Sie zeigen ja noch heute jene Mauer, an der die Mönche damals - wie böse Zungen behaupten - an Stricken emporzogen, was sie fürs Gefühl brauchten. An solcher Mauer gehst Du vorüber und fühlst Dich hämisch, brutal, unbarmherzig ausgeschlossen von allem Frohen, was dahinter vorgeht.
Das ist der Symbolismus der Mauer: Das Gotthelfeuch derer, die dahinter-, an die, die davorstehen.
Es braucht hinter der Mauer gar nichts vorzugehen, die Wirkung auf den, der davorsteht, bleibt dieselbe.
Warum umbauten dazumal die Besitzenden ihre Gärten mit Mauern so hoch, daß niemand hinübersehen noch klettern konnte? Wohl um ihre Äpfel und Birnen vor den Obstdieben zu schützen. Aber ganz gewiß auch, um den Neid der Besitzlosen nicht zu erregen. Sie sagten sich: Wenn ich im Frühjahr unter meinen blühenden Bäumen spazieren gehe, wenn ich in den Tagen der Rosen und in lauen Mondnächten Feste feiere, wenn ich im Sommer im Schatten meines Gartens mich ausruhe und wenn ich im Herbst meine Birnen und Äpfel breche, so will ich nicht, daß von draußen gierige, mißgünstige Augen mir zusehen, daß der Neid in den Seelen der Ärmeren wachse und in mein Besitzerglück einen übeln Beigeschmack mische.
So bauten sie die hohen Mauern um ihre Gärten und wähnten sich sicher, wie auf einer Glücksinsel, vor Neid und Mißgunst und Gier.
Es kam umgekehrt.
Die vor den Mauern standen, malten sich das Glück dahinter viel größer und rosiger aus, als es manchmal war. Sie wußten nicht, wie oft auf den schön gekiesten Gartenwegen die Sorge, die Unzufriedenheit, das Unglück spazieren gingen. Für sie waren hinter den Mauern immer Feste, von denen sie hartherzig ausgeschlossen blieben. Und da kam es so weit, daß sie die Mauern brachen und in die Gärten drangen und einsahen, daß sie auch jetzt noch nicht das ersehnte Glück geraubt hatten.
Aber die Folgenden bauten ihre Mauern nicht mehr so hoch, sie ersetzten sie durch Gitter, durch die der Blick in die Gärten frei war und sie schämten sich nicht mehr ihres Glücks und ihrer Freude. Dazu muß die Menschheit, die draußen sieht, allerdings erst noch erzogen werden. Heute kann es jedem frohen Mann, der einen Erfolg begießt, noch passieren, daß man ihn Schieber schimpft. Schnöde Heuchelei, denn alle möchten ja, wie gerne! auch einmal schieben, wenn sie wüßten, daß es nicht schief ginge.
In Echternach haben sie endlich damit begonnen, die größte der hohen Mauern niederzulegen, die Mauer, die sich zwischen Park und Sauerufer trennend erhob. In Zukunft wird der Spaziergänger im Park auch das Bild der Sauerlandschaft genießen können. Vielleicht fallen noch andere der hohen Mauern an den Straßen und Gassen Echternachs, weil dieser und jener einsteht: Wer sich der. Einsamkeit ergibt, ach, der ist bald allein.
Und vielleicht kommen einmal die Menschen so weit, daß sie neidlos fremdes Glück mit ansehen können, weil sie die Kraft in sich verspüren, selbst bis zum Glück durchzudringen.